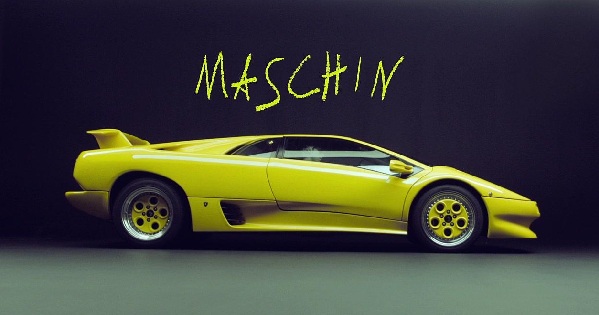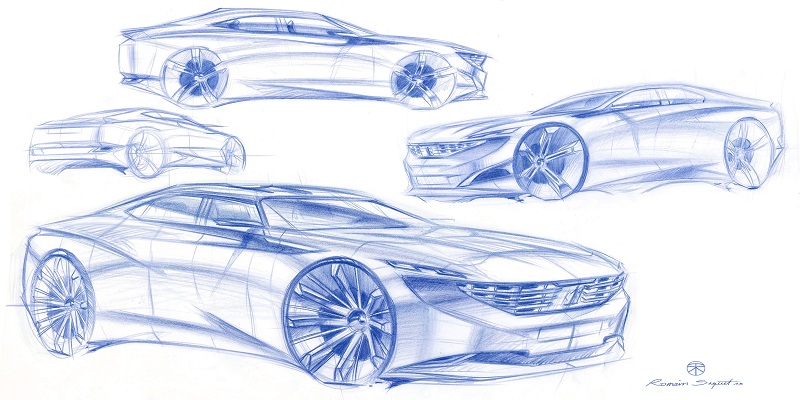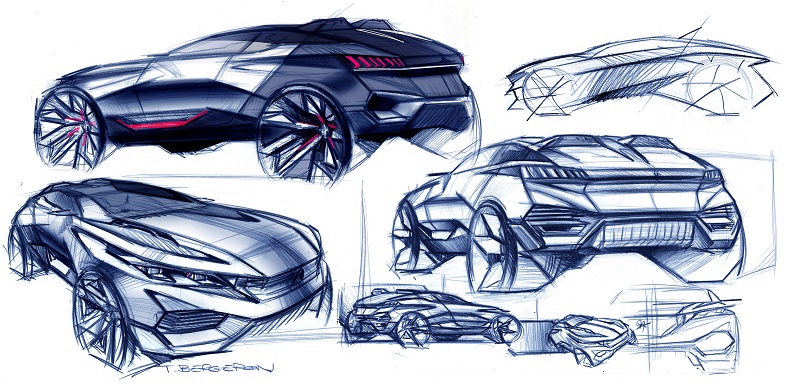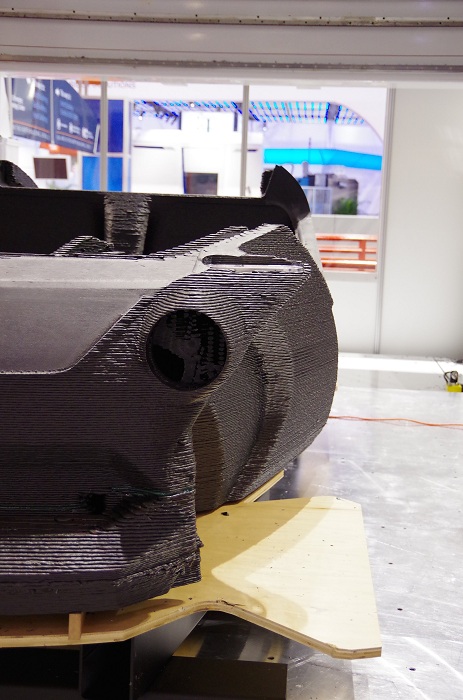„L-Zero“ Magnetschwebebahn geht in die Testphase
Den Shinkansen kennt jeder oder hat zumindest schon einmal was von den Bullet Trains Japans gehört, die aufgrund Ihres Aussehens und der hohen Geschwindigkeit, die sie erreichen den Spitznamen „Geschosszug“ tragen. Bis zu 320 h/km erreichen sie. Doch nun soll auch das Schnee von gestern sein, denn die neuen Maglevzüge, Magnetschwebebahnen, erreichen bis zu 581 km/h, ein Rekord der 2003 von den Japanern aufgestellt wurde. Sie sind es auch, die in die Testphase Ihres „L-Zeros“ schreiten, einem Maglevzug der wahrscheinlich um 2027 herum zwischen Nagoya und Tokyo verkehren soll. Dieser soll bei den im November anstehenden öffentlichen Vorführungen der Firma Central Japan Railway (ungefähr das Äquivalent der Deutschen Bahn) eine atemberaubende Geschwindigkeit von 500 km/h erreichen, für einen Passagierzug eine stattliche und auch ein wenig beängstigende Zeit. Das Besondere am „L-Zero“ ist, dass er anfänglich auf eine normale Geschwindigkeit von 160km/h beschleunigt, bevor das Maglevsystem sich einschaltet und übernimmt.
Positiv an der Maglevtechnologie ist nicht nur die Schnelligkeit mit der man von A nach B kommen könnte oder Güter transportieren könnte, sondern auch die Tatsache, dass die Wartungen der Einzelteile und der Maschinerie extrem gering gehalten werden würde, da das Maglevsystem lediglich auf einer Reihe von Magneten basiert, die die Levitation und Beschleunigung eines Objektes möglich machen ohne Reibung zu produzieren. Sie sind leiser und verbrauchen weniger Energie, haben einen engeren Kurvenradius, entgleisen schwerer, da sie Schienen umgreifend sind und sind belastbarer was Steigungen angeht. Das einzig negative daran ist der Kostenaufwand ein solches System in die urbane Infrastruktur zu integrieren. Der Motor erstreckt sich über den gesamten Fahrweg, da die Magneten auf der gesamten Schienenlänge angebracht werden, die Konstruktion müsste schwebend sein, kann also nicht in den „Straßenverkehr“ integriert werden und die Stromabnehmer müssen eine sehr hohe Leistung erbringen um den Zug fahren lassen zu können.
Der L-Zero soll mit seiner Art der doppelten Beschleunigung die Strecke zwischen Tokyo und Nagoya in 40 Minuten zurücklegen können. 286 Kilometer sind auf einer speziellen Route geplant, welche sechs Stationen miteinander verbinden. Shinagawa in Tokyo, Sagamihara in Kanagawa, Kofu in Yamanashi, Iida in Nagano, Nakatsugawa in Gifu und Nagoya. Japan ist einer der größten Investoren der Maglevtechnologie. Erst vor kurzem bot die japanische Regierung an, 1 Milliarde in eine Magnetschwebebahn zu investieren, welche die Insassen innerhalb von 15 Minuten von Washington nach Baltimore transportieren kann. New York ist eins der Expandierungsziele der Japaner – trotz der Riesenschritte Richtung Zukunft im eigenen Land. Momentan existiert eine Magnetschwebebahn. Sie wird in China betrieben und legt eine Strecke von 30,5 km in acht Minuten zurück, um die Passagiere vom Flughafen Shanghais in die Stadt zu bringen. Mit 431 km/h ist sie die derzeit schnellste operierende Bahn.
Text: Anna Lazarescu